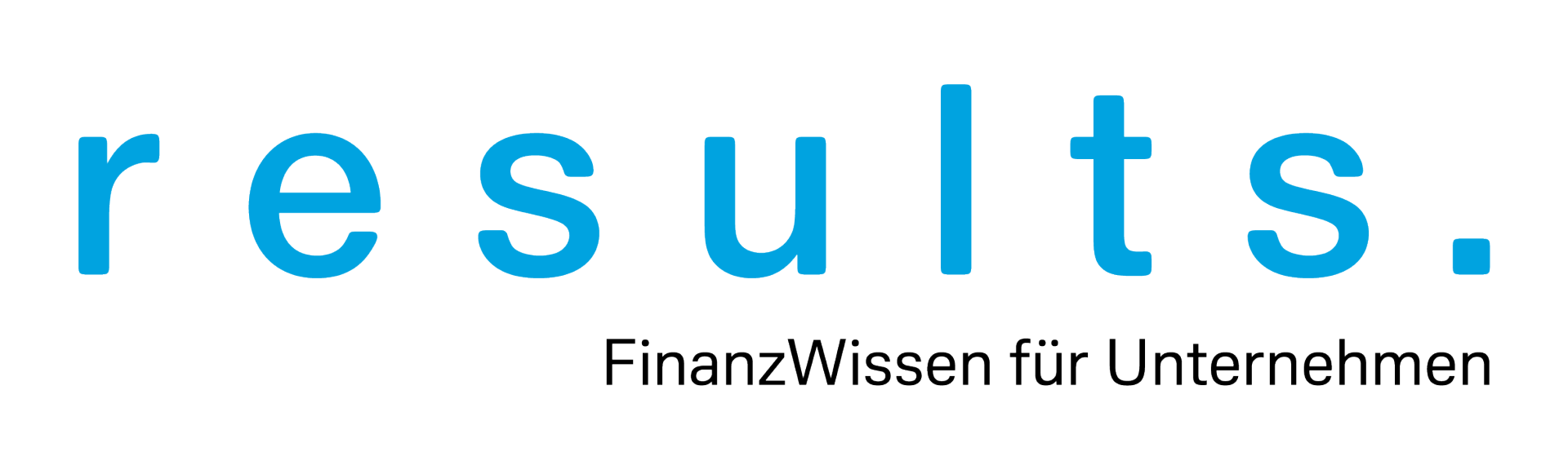
Handel mit dem Feind
Wie kann man nur Energie aus Russland beziehen, fragen viele. Die Wahrheit ist: Der Austausch von Waren mit rivalisierenden oder sogar verfeindeten Staaten ist keine Ausnahme, sondern die Regel.

Strafe durch Vernichtung: Vor den Toren Frankfurts ließen die Franzosen 1810 englische Waren verbrennen, die einen Weg durch die Kontinentalsperre gefunden hatten. Foto: CC-BY-SA/HISTORISCHES MUSEUM FRANKFURT/HORST ZIEGENFUSZ
Wer genau hinschaute, der konnte im Frühjahr 1807 in der Dunkelheit kleine Boote von Helgoland nach Südosten segeln sehen. Auf die Insel, damals unter dänischer Herrschaft, waren englische Waren gelangt, und die Boote brachten sie zum Festland, obwohl Napoleon jeglichen Handel mit Großbritannien verboten hatte. Mit der Kontinentalsperre reagierte er auf die Blockade französischer Häfen durch England im Jahr 1793 und auf die Erkenntnis, dass er die Briten militärisch nicht besiegen konnte.
Die Helgoland-Passage war nicht die einzige Schmuggelroute. Ob von Skandinavien oder dem Baltikum über die Ostsee, über den Atlantik nach Spanien und Portugal, über das Mittelmeer nach Sizilien, Malta und Triest: Ganze Küstenstriche lebten vom Handel mit dem Feind, und auch die wie immer neutrale Schweiz mischte mit. Die ökonomische Ratio der Bürger war stärker als der politische Wille.
„Neutrale“ Waren
Das ist kein Einzelfall. Im Ersten Weltkrieg importierte Deutschland über neutrale Staaten als neutral deklarierte Waren wie Nahrungsmittel, Metalle, Chemikalien oder Baumwolle, die in Wirklichkeit auf dem Territorium der Entente-Mächte produziert worden waren. Umgekehrt lieferten die Deutschen chemische Produkte und Maschinen an Kriegsgegner. Auch im Zweiten Weltkrieg gab es indirekten Austausch von Feindesgut über Mittelsmänner. Und immer wurde eifrig geschmuggelt.
Ein Teil dieses Handels zwischen Staaten, deren Männer sich an der Front bekriegten, lief an den Regierungen vorbei. Ein anderer aber war nicht nur geduldet, sondern – weil im eigenen Interesse liegend – sogar staatlich initiiert. So verwundert es auch nicht, dass die EU heute noch Waren von Russland bezieht. Zwar ging der Import 2024 gegenüber 2021 um fast 95 Prozent zurück (der Export um 72 Prozent). Wenn man allerdings berücksichtigt, dass etwa die europäischen Importe aus Kasachstan von 2021 auf 2022 um 50 Prozent und seitdem noch weiter gestiegen sind, kann man sich vorstellen, wie viele russische Produkte auf indirektem Weg zu uns kommen.

Foto: picture alliance / Vladimir Musaelyan/TASS
KP-Chef trifft Großkapitalisten
Leonid Breschnew und Armand Hammer fädelten den größten Deal zwischen den USA und der UdSSR ein.
Der Handel mit Russland in Zeiten politischer Spannungen hat Tradition. Auch im Kalten Krieg wurden Waren getauscht. Zwar war es ein Handel auf Sparflamme, der durch Embargos und Exportkontrollen auf beiden Seiten gehemmt wurde, dennoch fanden viele Rohstoffe ihren Weg von Ost nach West. Allerdings geschah das nicht immer im Konsens: Die Amerikaner kritisierten schon 1970 den unter Kanzler Willy Brandt geschlossenen „Erdgas gegen Röhren“-Vertrag westlicher Firmen mit der Sowjetunion. Unter Kanzler Helmut Schmidt wurde 1982 zusätzlich eine Pipeline von Sibirien bis Westeuropa beschlossen, für die die Deutschen Rohre und Kompressoren im Wert von 20 Milliarden Mark liefern und im Gegenzug jährlich 40 Milliarden Kubikmeter Gas erhalten sollten. Genüsslich erklärte Schmidt den entrüsteten Amerikanern, mit diesen Devisen könnten die Sowjets doch das Getreide aus den USA bezahlen.
... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.
Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.
Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.
Da hatte Schmidt einen Punkt, denn auch in die Gegenrichtung wurde geliefert, und zwar neben Getreide vor allem Maschinen, Industrieanlagen, Chemikalien, Konsumgüter und sogar Technologie. Schillerndste Figur auf amerikanischer Seite war Armand Hammer, von 1957 bis 1986 Chef der US-amerikanischen Ölgesellschaft Occidental Petroleum. Der 1898 in Manhattan geborene Sohn eines aus Odessa eingewanderten Sozialisten arbeitete als Arzt in der frisch gegründeten Sowjetunion und schloss mit Lenin persönlich ein Handelsgeschäft über Weizenlieferungen gegen Pelze und Kaviar ab. Bis zum Ende des Kalten Krieges blieb Hammer eine wichtige Figur für den Handel zwischen USA und UdSSR. 1973 gelang ihm der bis dahin größte Deal der Amerikaner mit den Sowjets: Die USA lieferten Technologie und Ausrüstung für Düngemittelfabriken in der Sowjetunion und erhielten dafür Ammoniak, Kali und Harnstoff. Das lohnte sich nicht nur finanziell: Generalsekretär Leonid Breschnew verlieh Hammer 1978 den Orden der Freundschaft.
Schillernde Figuren
Aus deutscher Sicht nicht weniger skurril war der DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski. Der Leiter des geheimen Bereichs für Kommerzielle Koordinierung im Ministerium für Außenhandel handelte nicht nur 1983 mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß den berüchtigten von der Bundesrepublik verbürgten Bankkredit in zwei Tranchen über knapp zwei Milliarden D-Mark aus (im Gegenzug verpflichtete sich die DDR zum Abbau von Selbstschussanlagen an der innerdeutschen Grenze) – insgesamt 27 Milliarden Mark soll der „dicke Alex“ der vor dem Bankrott stehenden DDR besorgt haben. Seiner Dissertation „Vermeidung ökonomischer Verluste und Erwirtschaftung zusätzlicher Devisen“, die bis zum Ende der DDR geheim blieb, machte er alle Ehre.
Tatsächlich hat es immer Geschäfte zwischen der Bundesrepublik und der DDR gegeben. Der institutionelle Rahmen dafür war der von den Alliierten errichtete Interzonenhandel. Die Bundesrepublik war in den Fünfzigerjahren noch auf Nahrungsmittel aus der DDR angewiesen, die DDR erhielt neben Stahl und Eisen auch Maschinen und Elektrogeräte. Sogar nach dem Mauerbau verzichtete die Bundesregierung auf Eingriffe in den innerdeutschen Warenverkehr. Tatsächlich blieben die formalisierten Gespräche über den innerdeutschen Handel jahrzehntelang der entscheidende Kommunikationskanal der beiden Staaten, in dem über größere politische Fragen gesprochen werden konnte.
Manchmal wurden aber auch klare Grenzen gesetzt. 1986 teilte die Sowjetunion dem überraschten Generalsekretär des GATT (des Vorläufers der Welthandelsorganisation WTO) mit, dass sie zur Verbesserung des Welthandels einen Beobachter zur nächsten Konferenz schicken wolle – dem erteilte US-Präsident Ronald Reagan umgehend eine Absage. Allerdings war mit dem Gipfeltreffen zwischen Reagan und Gorbatschow in Genf wenige Monate zuvor schon der Schalter auf Entspannung umgelegt worden. Die regen Handelsbeziehungen in den frostigen Zeiten dürften da nicht geschadet haben.
11/2025
Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.


