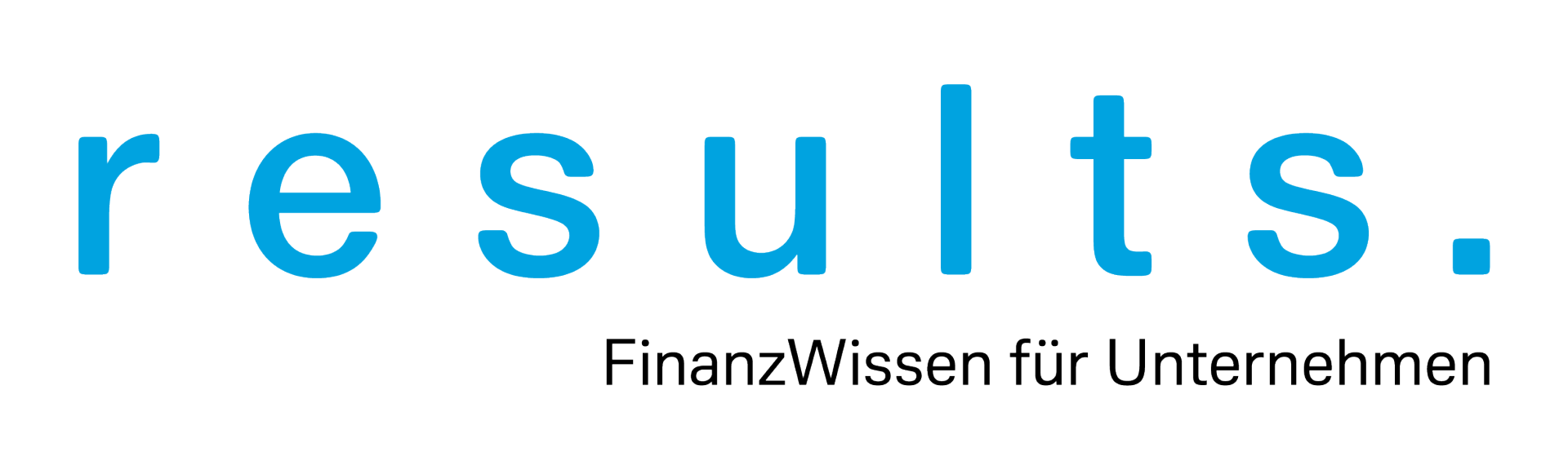
KI bei Trade Finance & mehr
Die Euphorie über die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist groß. Doch was ist schon möglich – und was noch Zukunft?

Die Finanzierung von grenzüberschreitendem Handel wird mit KI und Digitalisierung nicht nur schneller. Foto: Adobe Stock
Es ist stiller geworden um die Blockchain. 2019 hieß es noch in einem Artikel der „Financial Times“: Die Blockchain-Technologie könne den Trade Finance-Bereich radikal umkrempeln. Denn für eine grenzüberschreitende Transaktion sei der Austausch von 36 Dokumenten und 240 Kopien nötig. Bis 2050 könne dank Blockchain alles digital abgelegt werden. Mit der Blockchain könne jeder Beteiligte in Echtzeit sehen, was sich bei einer Trade-Finance-Transaktion gerade tue. Es sei ein riesiger Fortschritt bei Kosten und Verfügbarkeit. Doch fragt man heute nach aktuellen Entwicklungen, wird meist abgewunken: Künstliche Intelligenz (KI) ist die viel näherliegende Lösung, um Trade Finance günstiger, schneller und weniger fehleranfällig zu machen. Wie weit ist aber die Umsetzung schon wirklich – oder geht es auch jetzt wieder vor allem um technische Potenziale?
4
Milliarden neue Papiere jährlich umfasst lt. Schätzungen der Dokumentenaustausch von Banken im Trade-Finance-Bereich.
Christina Gnad, Global Head of Working Capital bei der Deutschen Bank, berichtet: „Sowohl in den Banken als auch in den Unternehmen selbst ist bereits vieles in Bewegung. Längst nicht alles ist schon im Regelbetrieb, aber es geht voran.“ Allerdings bezögen sich die meisten Projekte noch auf interne Prozesse. Gnad: „Unternehmen sind noch zurückhaltend, KI im Außenkontakt zu nutzen, beispielsweise automatisierte E-Mails. Darum werden die neuen digitalen Möglichkeiten vor allem mit dem eigenen Datenbestand genutzt.“ Doch schon dort kann der Mehrwert erheblich sein, besonders bei Dokumenten. Auf 4 Milliarden neue Papiere jährlich wird der Dokumentenaustausch von Banken im Trade-Finance-Bereich laut Internationaler Handelskammer (ICC) UK geschätzt. Vieles davon muss noch händisch bearbeitet werden, weil die Schriftstücke uneinheitlich sind und zum Teil noch von Hand in unterschiedliche Systeme eingetragen werden müssen.
„Die neuen digitalen Möglichkeiten werden bislang vor allem mit dem eigenen Datenbestand genutzt.“
Christina Gnad, Global Head of Working Capital, Deutsche Bank
KI liest Trade-Finance-Dokumente
Seit Jahrzehnten gibt es OCR-Anwendungen – Software, die aus Dokumenten Informationen extrahieren kann, die sich beispielsweise direkt in Datenbanken einfügen lassen. Für unstrukturierte Dokumente haben sich mit der weiteren Entwicklung von KI die Ergebnisse bereits deutlich verbessert. Sie brauchen aber weiterhin eine menschliche Kontrolle, um zum Beispiel sicherzustellen, dass Fehleingaben in einem falschen Feld entdeckt und der Fehler nicht übertragen wird. „KI kann Daten vorbereiten und Plausibilitätsprüfungen vornehmen und so die manuelle Datenerfassung reduzieren und die Datenqualität verbessern“, erläutert Tilman Götz aus dem Trade Finance Product Management der Deutschen Bank.
... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.
Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.
Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.
„KI kann Daten vorbereiten und Plausibilitätsprüfungen vornehmen und so die manuelle Datenerfassung reduzieren und die Datenqualität verbessern.“
Tilman Götz, Trade Finance Product Management, Deutsche Bank
Relevant ist dies beispielsweise bei der Verarbeitung, Identifizierung und Erfassung großer Datenmengen aus unstrukturierten Akkreditivdokumenten und freien Feldern innerhalb von Swift-Nachrichten vom Typus MT7XX. Schnell können hier Daten unvollständig und fehlerhaft sein. Treten Schwierigkeiten auf, kann sich die End-to-End-Abwicklung verzögern. Die Deutsche Bank hat daher ein System, das die Inhalte aus den Feldern 45A (Warenbeschreibung), 46A (erforderliche Dokumente) und 47A (zusätzliche Bedingungen) extrahiert und strukturiert. So können beispielsweise Häfen, Orte, Güter und Parteien identifiziert werden, die für nicht-finanzielle Risikoprüfungen relevant sind.
Probleme schneller identifizieren
Aktuelle geopolitische Konflikte mit entsprechenden Sanktionen und Handelsbarrieren haben diese Risiken noch einmal verstärkt. Sie zu prüfen, ist wegen der Vielzahl an Vorschriften und Veränderungen nicht einfach. „Solche Eignungs- und Durchführbarkeitsprüfungen verlängern die Bearbeitungszeit, da die Kontrollen teilweise manuell per Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip durchgeführt werden. Das führt zu einem Abstimmungsbedarf zwischen den verschiedenen Verantwortlichen“, berichtet Götz. Mit KI lassen sich Daten schneller extrahieren und prüfen und damit die Durchlaufzeiten für die Kunden reduzieren.
Auch die Identifizierung des HS-Codes für die angegebene Warenbeschreibung hilft, den möglichen Dual-Use-Zweck (Güter, die sowohl zivil als auch für militärische Zwecke verwendet werden können) im Rahmen von Due-Diligence-Prüfungen zu bestimmen. So kann erkannt werden, ob (ungewollte) Embargo-Verstöße riskiert werden. „Mit der digitalen Datenanalyse wird es auch möglich, anhand von Verhaltensabweichungen in der Logistikkette mögliche Verstöße besser zu erkennen“, fügt Christina Gnad hinzu. „Der KI fällt auf, wenn ein Frachtschiff für einige Zeit offline geht. Dann können wir gezielt nachhaken, ob es dafür einen guten Grund gibt – oder etwas verschleiert werden soll.“ Macht solche Transparenz Unternehmen Angst? „Im Gegenteil, denn wir helfen damit ja, Risiken zu reduzieren.“
Gnad und Götz betonen aber auch, dass sich viele neue Möglichkeiten erst in der Erprobung befinden. „Wir sehen viele Ansätze und entwickeln auch, teils gemeinsam mit Kooperationspartnern, Ideen, wie Trade Finance schneller, zuverlässiger, günstiger werden kann. Aber bevor wir das fest in unsere Arbeit integrieren, braucht es natürlich eine genaue Praxisprüfung und klare Kontrollprozesse für diese Modelle“, erläutert Götz.
Working-Capital-Finanzierung optimieren
Interessante Entwicklungen gibt es auch rund ums Working Capital. Während sich in vielen Bereichen die Erwartungen an die Nachfrage nach Pay-per-Use-Angeboten nicht erfüllt haben, gilt das weniger für Energie-Lösungen, berichtet Götz. Bei „Energy Efficiency as a Service“ (EEaaS) erwirbt der Finanzierer die Energieanlage vom Hersteller/technischen Partner. Der Endkunde zahlt einen Teil seiner erreichten Einsparung als Entgelt über den technischen Partner an den Finanzier/die Bank. So braucht der Kunde keinen Kredit, profitiert durch „Performance Contracting“ von garantierten Energiekosteneinsparungen und der Hersteller erhält aus dem Verkauf sofort sein Geld aus dem Verkauf der Energieanlage.
Zum Beispiel stellt ein Kunde der Deutschen Bank seinen Mitarbeitern Ladesäulen für E-Autos auf dem Firmengelände zur Verfügung. Die Finanzierung der Ladeinfrastruktur erfolgte durch die Bank, abgerechnet wird per Verbrauch.
Durch eine Digitalisierung der Lagerhaltung können Finanzierungspartner in Echtzeit verfolgen, welche Waren entnommen werden. Das erlaubt nicht nur eine passgenauere Vorfinanzierung des Lagers, sondern könnte auch die direkte Übergabe an die Forderungsfinanzierung ermöglichen. „Je besser das Tracking, desto geringer die Unsicherheit für die Finanzierer. Diese sind dann eher bereit, die Finanzierungsquote zu erhöhen“, sagt Gnad.
Im Factoring – hier sind wir wieder nahe an der Dokumentenprüfung mit der Datenextraktion und Strukturierung – kann KI helfen, Rechnungen Unternehmensvorgängen zuzuordnen und mögliche Risiken zu prüfen. Bessere Daten helfen nicht nur bei Inventory Finance oder Payables Finance, auch die Konditionen von ESG-gebundenen Krediten können entsprechend der Zielerreichung flexibel angepasst werden.
Ein Blick in die digitale Zukunft
Einige Kunden nutzen Möglichkeiten wie „Energy Efficiency as a Service“ bereits, andere Anwendungsmöglichkeiten warten noch auf ihre Umsetzung: Echtzeitentscheidungen, die eine KI auf Basis ihrer eigenen Analysen trifft, sind bislang erst in der Entwicklung. Denkbar sind zum Beispiel dynamisches Skonto oder eine automatisierte Limitvergabe. Auch die vollautomatische Angebotserstellung (und -annahme) ist noch nicht realisiert; zu groß werden die Risiken eingeschätzt, die durch Fehler der KI entstehen könnten. Dabei geht es nicht nur darum, mögliche KI-inhärente Fehlentscheidungen zu vermeiden, sondern auch die KI gegen die gezielte Manipulation von außen abzusichern.
Eine Hürde ist auch die mangelnde Bereitschaft von Unternehmen, ihre Daten zu teilen. „Wir erleben, dass Unternehmen manchmal ihre Daten lieber mit einem Fintech teilen als mit einer Bank, obwohl diese viel stärker reguliert ist“, berichtet Gnad. Das mache ein „Embedded Finance“ schwierig, bei dem der Finanzierungspartner anhand der Kundendaten erkennen könne, wo akuter Finanzierungsbedarf bestehe. Doch Gnad und ihre Kollegen arbeiten schon an einer Lösung, die helfen könnte: Unternehmen würden ihre Daten nur mit einem spezialisierten Datendienstleister teilen, ohne der Bank einen direkten Zugang zu gewähren. Die Bank wiederum könnte diesem „Datentreuhänder“ konkrete finanzierungsrelevante Anfragen übermitteln. Doch bevor die Analyse erstellt würde, könnte der Kunde sein Veto einlegen.
Trade Finance, Working Capital Management und Pay-per-use-Modelle nutzen bereits neue digitale Möglichkeiten, doch auch sie haben diese noch lange nicht ausgereizt.
09/2025
Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.


