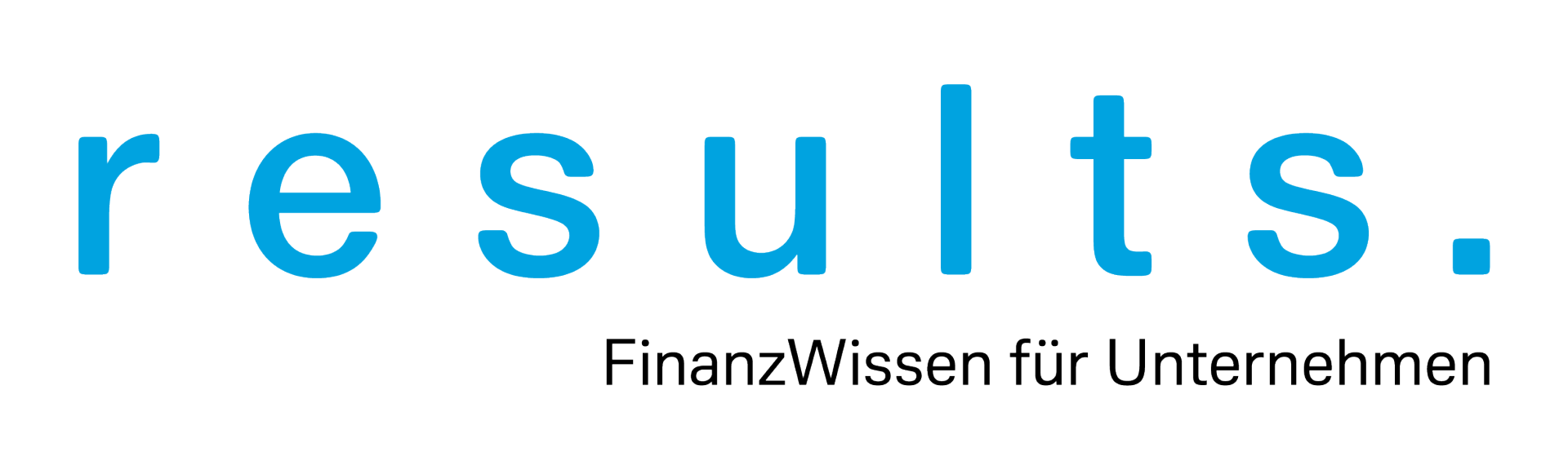
Unternehmen zukaufen und anbauen
Viele Private-Equity-Fonds setzen als Wachstumstreiber für ihre Beteiligungen auf „Buy and Build“. Was können Familienunternehmen von dieser Akquisitionsstrategie lernen?

In kleinen Schritten zum Großen: Buy and Build-Akquisitionsstrategien können auch für Familienunternehmen interessant sein. Foto: Pic4/Ai generated
Auch Finanzinvestoren unterliegen Moden. Galt vor 20 Jahren noch „Financial Engineering“ als Schlüssel zur Wertsteigerung ihrer Beteiligungen, geht es seit einigen Jahren kaum noch ohne „Buy and Build“. Mit strukturierten, meist mehreren relativ kleinen Zukäufen ergänzen die Investoren eine initiale Beteiligung (Anker oder Plattform genannt) innerhalb weniger Jahre. Die Zukäufe – Add-ons genannt – stärken das Anker-Unternehmen auf ganz unterschiedliche Weise: Typisch sind eine horizontale Konsolidierung mit Unternehmen aus derselben Branche oder eine vertikale Erweiterung der Wertschöpfungskette. Ziel ist dabei meist, durch Synergien wie gemeinsame Ressourcennutzung oder Cross-Selling eine bessere Marktposition zu erreichen. Am Ende sollte der Wert der Plattform über der Kaufsumme der Einzelteile liegen. Investoren profitieren zudem von einer Multiple-Arbitrage: Kleinere Add-ons werden meist zu niedrigeren Bewertungsmultiplikatoren gekauft. Der größere Konzern wird beim Exit hingegen meist mit einem Premium-Multiple bewertet.
„Überschneidungen im Produkt- und Kundenportfolio sollten bei horizontaler Konsolidierung vorher sorgfältig bewertet werden.“
Stephan von Vultejus, Deutsche Bank
Es lässt sich nicht pauschal beurteilen, welche Akquisitionsstrategie erfolgversprechender ist. Die horizontale Konsolidierung kann einen schnellen Wachstumsschub ermöglichen, weil der Anteil im bestehenden Markt sprunghaft erweitert wird. Die Integration ähnlicher Unternehmen verspricht Einsparungen durch einen gemeinsamen Einkauf und gemeinsame interne Abteilungen wie Personal, Marketing, Compliance, Finance und Qualitätsmanagement. Darüber hinaus kann gegenüber Kunden die Verhandlungsposition gestärkt werden; und eine Mehrmarkenstrategie kann helfen, neues Erlöspotenzial zu heben. Horizontale Konsolidierungen sind jedoch aus kartellrechtlichen Gründen nicht immer möglich. Außerdem werden sie leicht in ihrer Komplexität unterschätzt. Stephan von Vultejus, Director Merger & Acquisitions bei der Deutschen Bank, empfiehlt: „Überschneidungen im Produkt- und Kundenportfolio sollten vorher sorgfältig bewertet werden.“ In der Post-Merger-Integration-Phase müssen Doppelstrukturen rasch bereinigt werden, ohne einen Unternehmensteil zu demotivieren. Das führt rasch zu Unruhe in der Belegschaft (und damit auch schnell bei anderen Stakeholdern).
Vertikale Integration
Bei der vertikalen Integration wird entlang der Wertschöpfungskette entweder „rückwärts“ (upstream) oder – deutlich seltener – „vorwärts“ (downstream) hinzugekauft. Bei Upstream-Zukäufen wird zum Beispiel ein Zulieferer erworben, bei Downstream eine Vertriebsgesellschaft. Auch eine „technologische Vertikalisierung“ ist häufig zu beobachten, wenn gezielt ein bestimmtes Know-how erworben wird. Von Vultejus erläutert: „Vertikale Akquisitionsmodelle helfen, kritische Vorprodukte oder Rohstoffe zu sichern und die Abhängigkeit von Dritten bei Qualität, Preis und Lieferzuverlässigkeit zu reduzieren. Oder, bei Downstream, den Marktzugang zu optimieren.“ One-Stop-Lösungen erhöhen außerdem das Erlöspotenzial, Markteintrittsbarrieren steigen, durch den Verzicht auf externe Partner können Einsparungen erzielt werden.
Auch diese Strategie ist nicht ohne Risiken. Kernkompetenz und Fokus können verloren gehen. Neue Geschäftsmodelle, Technologien oder Produkte, die das Management bislang nicht gut kennt, müssen integriert werden. Oft treffen auch unterschiedliche Prozesse und Unternehmenskulturen aufeinander: etablierter Mittelständler trifft auf Tech-Start-up, ingenieurlastiger Produzent auf Vertriebsmaschine.
... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.
Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.
Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.
Schrittweises Vorgehen
Nur: Diese Vor- und Nachteile gelten grundsätzlich für Akquisitionen. Der Unterschied bei „Buy and Build“ liegt im seriellen Vorgehen. Statt eines Mega-Deals werden mehrere kleine Zukäufe getätigt, teilweise im Abstand von sechs bis zwölf Monaten, manchmal dauert es noch länger.
Das sequenzielle Vorgehen hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen hat die Plattform-Organisation Zeit, sich anzupassen. Da zudem die Größenverhältnisse meist relativ klar sind, stellt sich die Frage nach „Koch und Kellner“ weniger; häufig übernimmt das Target auch wichtige Strukturen und Prozesse des Anker-Unternehmens. Zugleich kann die Plattform aber auch aus den Erfahrungen des Zukaufs und der Integration lernen und entsprechend Vorgehen und Prozesse für das nächste Add-on verbessern. Die Plattform entwickelt so eine Best-Practice-Erfahrung, die skaliert werden kann. Auch kann die Kalkulation, welche Synergien wirklich gehoben werden, realistischer werden. Zugleich gilt: Je größer die Plattform wird, desto schwieriger wird es insbesondere für kleinere Wettbewerber, diesen Vorsprung bei Einkauf, Marktpräsenz oder Innovationskraft aufzuholen. Das macht es der Plattform wiederum leichter, weiter zu konsolidieren und die Marktführerschaft auszubauen. In manchen Auslandsmärkten wie Frankreich oder USA gelingt es häufig nur mit Zukäufen von dort bereits etablierten Unternehmen, erfolgreich Fuß zu fassen.
Ein weiterer Vorteil: Größere Übernahmen fordern häufig die gesamte Organisation des Käufers wie auch des Targets für mehrere Monate. In dieser Zeit ist das Unternehmen weitgehend mit sich selbst beschäftigt und vernachlässigt zwangsweise externe Stakeholder, insbesondere Kunden oder die Weiterentwicklung von Produkten und Leistungen. Diese Gelegenheit nutzen Wettbewerber gern, um ihrerseits Marktanteile zu erobern.
Übertragbar auf Familienunternehmen?
Viele Argumente sprechen für „Buy and Build“, zahlreiche Beispiele aus dem Portfolio von Private-Equity-Investoren zeigen die Stärken des Vorgehens auch aus Bewertungsgründen. Aber lässt sich die Plattform-Strategie auf Familienunternehmen übertragen?
Grundsätzlich ja, allerdings müssen drei Voraussetzungen hinsichtlich Finanzen, Strukturen und Management erfüllt sein:
- Finanzielle Kraft des Anker-Unternehmens (und seiner Gesellschafter)
Zukäufe erfordern Kapital. Finanzinvestoren können in aller Regel auf externe Eigenkapital-Finanzressourcen zugreifen, die ihnen eine attraktive Fremdkapitalfinanzierung ermöglichen. Familienunternehmen und/oder ihre Gesellschafter benötigen entsprechende Ressourcen, um ebenfalls über einen längeren Zeitraum mehrere – wenngleich kleinere – Akquisitionen zu finanzieren.
Doch mit der Finanzierung des Kaufpreises allein ist es selten getan. Auch die Integration erfordert Investitionen; verläuft die Integration nicht wie geplant, können Liquiditätslücken entstehen. Darum ist ein entsprechender Kapitalpuffer wichtig, damit sich der Käufer nicht „verschluckt“. - Strukturelle Voraussetzungen des Ankers
Längst nicht jedes Unternehmen ist als Plattform geeignet. Im Mittelstand sind „gewachsene“ Prozesse weit verbreitet, die aber für Wachstumssprünge ungeeignet sein können. Eine veraltete, individuell geschneiderte IT-Infrastruktur kann dann schnell zum Nadelöhr bei der Integration werden. Engpässe kann es beispielsweise auch leicht in der Personalabteilung geben, die in kurzer Zeit neue Mitarbeiter integrieren muss.
Bevor ein Unternehmen als Plattform fungieren kann, braucht es daher häufig eine entsprechende Vorbereitung. - Erfahrung und Kapazität des Managements
Zukauf und Integration von Unternehmen sind sehr zeitaufwendig: Targets müssen identifiziert und geprüft, Verhandlungen geführt und zum Abschluss gebracht werden. Auch die anschließende Integration erfordert meist die volle Aufmerksamkeit des Managements und weiterer wichtiger Entscheider. In diesen Themen haben aber mangels Erfahrung nur die wenigsten Manager in Familienunternehmen Know-how aufgebaut. Zugleich muss das operative Geschäft weitergeführt werden. Private-Equity-Fonds hingegen verfügen über ein eingespieltes Team an Transaktionsspezialisten, die die neuralgischen Punkte von Akquisitionen kennen. Und sie verfügen über ein Netzwerk erfahrener Spezialisten, die das Kernteam bei Engpässen unterstützen können. Familienunternehmen halten keine Managementkapazitäten vor; diese müssten für eine Buy-and-Build-Strategie erst (teuer) aufgebaut werden. Ebenso fehlen ihnen die Erfahrungen, welche Netzwerkpartner für sie am besten geeignet sind.
Doch Familienunternehmen können auch Vorteile bei „Buy and Build“ gegenüber Finanzinvestoren haben. Zum einen haben sie oft einen längeren Investitionshorizont. Sie sind nicht an fixe Fondslaufzeiten gebunden und können daher eine Plattform-Strategie bei Marktveränderungen oder mangelnden Targets auch pausieren. Bei der Integration sind sie ebenfalls zeitlich flexibler. Da sie zudem seltener den Renditeerwartungen externer Investoren genügen müssen, sind sie beweglicher in der Ausgestaltung von Kaufpreisen oder Beteiligungsanteilen des Managements aus dem Target-Unternehmen.
„Eine Buy-and-Build-Strategie erfordert aber stets eine ausreichende Vorbereitung“, rät von Vultejus. Dazu gehören die Erarbeitung einer schlüssigen Plattform-Strategie, die Etablierung von Kapitalzugängen auf Eigen- und Fremdkapitalseite, der Aufbau von Governance-Strukturen inklusive eines professionellen Finanz-Reportings und das Knüpfen eines Netzwerks zu externen Beratern wie M&A-Anwälten und -Beratern sowie zu einem akquisitionserfahrenen Beirat. Auch sollte schon frühzeitig geprüft werden, wie gut sich das Anker-Unternehmen für die spätere Integration eignet.
Das ist viel Arbeit. Allerdings würde diese in aller Regel auch bei einer Einmal-Übernahme anfallen. „Buy and Build“ erlaubt, Großes auch in kleinen Schritten zu errichten – und reduziert dabei die Risiken eines einmaligen Fehlgriffs. Am Ende kann ein Unternehmen stehen, das sich auch für die eigene Nachfolge des Familienunternehmers deutlich besser eignet, weil es für unterschiedlichste Nachfolger deutlich attraktiver geworden ist.
10/2025
Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.


