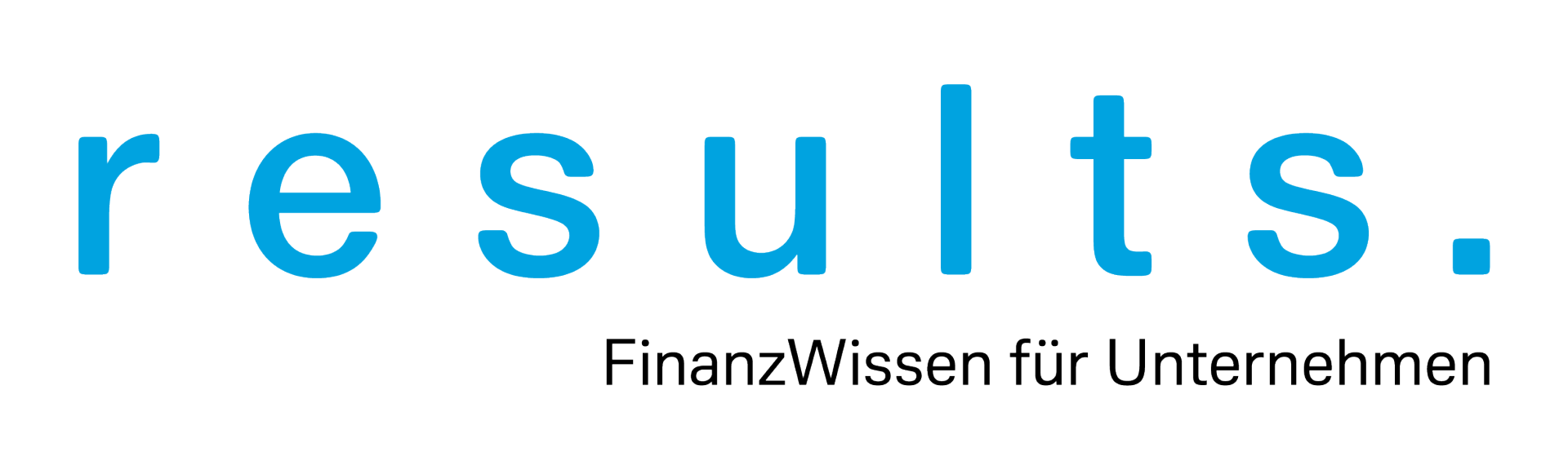
... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.
Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.
Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.
Groß gedacht, groß geliefert
Seit Menschen in großen Gemeinschaften leben, schieben sie große Projekte an. Viele davon bestaunen wir noch heute, mit anderen verbinden wir gemischte Gefühle. [mehr...]
Tausche Freiheit gegen … was genau?
Wann sind wir bereit, auf unsere demokratischen Rechte zu verzichten? Die Vergangenheit zeigt: wenn wir uns fürchten, gierig werden oder uns nach Ruhe sehnen. [mehr...]
B2B-Webshops: Mitgespielt oder ausgespielt
Der Vertrieb verlagert sich ins Digitale, Marktplätze übernehmen im B2B-Bereich komplette Wertschöpfungsketten. Das ist eine Chance für Unternehmen wie für Banken – sie müssen sie nur ergreifen. [mehr...]
Der Leverage: mehr Schulden für mehr Gewinn
Finanzinvestoren wissen genau: Fremdkapital ist ein wunderbarer Hebel, um Rendite zu maximieren. In der Theorie funktioniert das stets reibungslos. Sollte auch der Mittelstand mehr Risiko in der Finanzierung wagen? [mehr...]
results. Event
Aktuelle Vorträge und Diskussionen
Fachleute bieten ihr Spezialwissen, Beobachter ihre Einschätzungen, Unternehmer ihre Erfahrungen: ob online oder physisch – Veranstaltungen sind unersetzlich für aktuelle Informationen und spannende Netzwerke.

results. Nahaufnahme
Innovation im 3D-Druck: Forschung trifft auf Unternehmergeist
Was passiert, wenn sich ein Physiker, ein Chemiker und Seriengründer zusammentun? Innovation, die aus einer Idee entsteht und zum Gamechanger für Wissenschaft und Industrie wird. Das erleben gerade die Gründer und MitarbeiterInnen der xolo GmbH, deren Produkte gerade ihren Weg in die verschiedenen Industrien finden. Das Berliner Startup hat ein weltweit einzigartiges Verfahren entwickelt, das den 3D-Druck revolutioniert. Den volumetrischen 3D-Druck. Mit Licht und Harz drucken sie in ein paar Minuten kleinste Teile für Medizin, Optik und sogar die Schmuckindustrie. Gedruckt wird ohne Schichten, Gegenstände sind quasi “am Stück”. Für results. Nahaufnahme hat die xolo GmbH die Labortüren geöffnet und einen exklusiven Einblick in die Zukunft des Druckens gewährt. Wir haben gelernt, wie Bioprinting funktioniert, warum optische Linsen plötzlich in Minuten entstehen und wie personalisierte Medizin Leben retten kann.
Digitaler Bergbau - Salzgewinnung für Deutschland
Im Kaliwerk des Rohstoff-Spezialisten K+S werden essenzielle Salze gefördert, die als Dünger unsere Ernährung sichern, in Textilien, Medikamenten – und sogar im Glas von Smartphone-Displays – stecken. Für die Reihe results. Nahaufnahme begleitet Jürgen Schmitt den K+S-Vorstand Christian Meyer direkt an die Rohstoffquelle.
Heute analysieren Sensoren in Echtzeit die Abbruchstellen, Spezialgeräte bewegen tonnenschwere Salzladungen – eine einzige Schaufel fasst mehrere Tonnen. Digitalisierung unter Tage. Damit der Abbau des wertvollen Rohstoffs wirtschaftlich und nachhaltig bleibt, braucht es nicht nur hohe, langfristige Investitionen, sondern auch smarte Datenanalysen und stabiles Internet in 500 Metern Tiefe.
Wie viele Tonnen Salz eine einzige Schaufel fasst und warum diese Ressource unsere Lebensqualität bestimmt? Die Antworten finden Sie im Video.
Kooperative Plattformmodelle – Digitalisierung bis zur Zahlungsabwicklung
Wenn Spediteure binnen Minuten einen Auflieger benötigen, können sie das mittlerweile per App erledigen, statt zum Telefonblock zu greifen. Fleetloop, ein gemeinsames Startup der Logistikunternehmen Greiwing und Schmitz Cargobull, hat den Mietprozess digitalisiert. Die Plattform vernetzt Trailer, Telematik und Finanzunternehmen miteinander, so wird der gesamten Bezahlprozess in einem durchgängig digitalen Mietprozess inkludiert. Wie das Modell funktioniert, welche Rolle Kooperationen spielen und warum besonders Mittelstandsunternehmen davon profitieren, sehen Sie es im Video mit Matthias Cordes, Fleetloop Chief Product Officer, und Jürgen Schmitt von der Deutschen Bank.
International
Finanzierung
Das könnte Sie auch interessieren
results. UnternehmerPodcast
Jubiläumsausgabe: Neuausrichtung mit KI
Feiern Sie mit uns - die inzwischen 60. Folge des beliebten results. UnternehmerPodcast ist online:
Die Künstliche Intelligenz ist für viele Unternehmen eine Herausforderung - oder eine Chance. Dr. Christian Graup, Gründer und Geschäftsführer der aiio GmbH, eines auf Prozessmanagement spezialisierten Softwareunternehmens, berichtet im Podcast von den Gründen und Widrigkeiten bei der Neuausrichtung seines Unternehmens.










