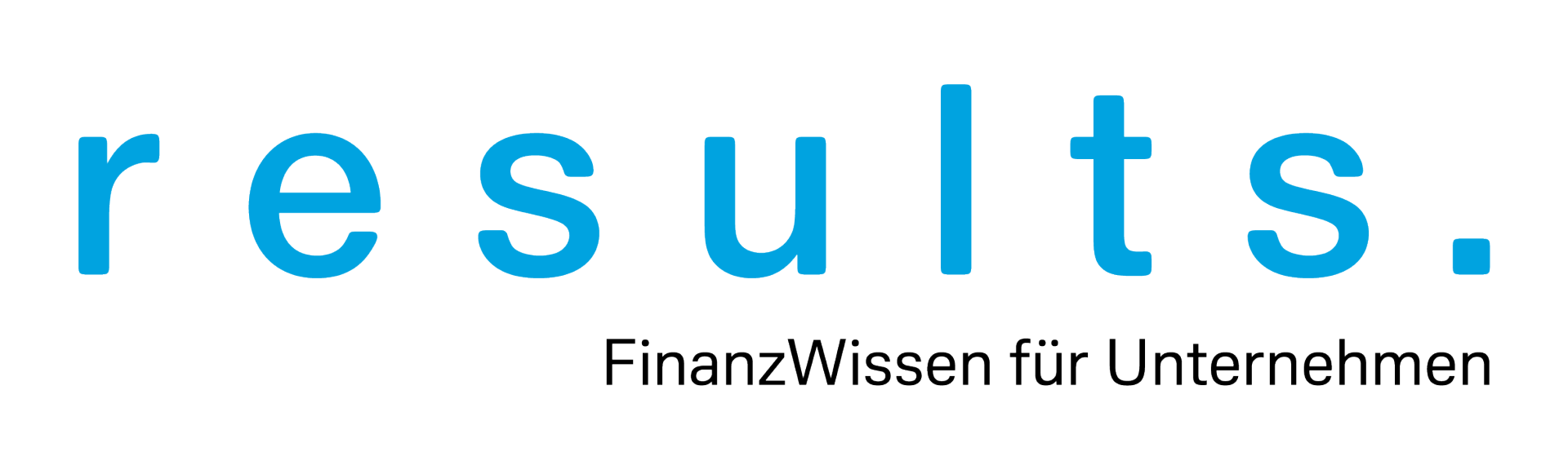
Was macht Holacracy heute?
Vor einer Dekade machten neue Organisations- und Führungsansätze wie Holacracy, Beyond Budgeting oder Teal Organizations Schlagzeilen. Manche der radikalen Ideen wirken fort.

Ein Online-Schuhhändler erfand Holacracy, eine radikale Form der Selbstorganisation. Doch nach anfänglicher Euphorie zeigten sich die Schwächen der Struktur. FOTO: JCADA@ZAPPOS.COM
Welcher Chef bekommt von seinen Mitarbeitern schon einen Tesla als Dankeschön geschenkt? So erging es Dan Price, Gründer und CEO des US-Finanzdienstleisters Gravity Payments, 2015. Allerdings hatte er davor auch sein Gehalt freiwillig von 1,1 Millionen auf 70 000 US-Dollar gesenkt und allen anderen Mitarbeitern ein Mindestgehalt in dieser Höhe zugesichert. Diese Lohnpolitik kam bei der Belegschaft gut an, bei vielen verdoppelte sich das Einkommen. Die Medien feierten den sozialen Vorreiter. Aber es gab auch Kritik, nicht nur von Investoren und Ökonomen, die Price’ Einheitslohn als „sozialistisches Experiment“ verhöhnten. Price’ Bruder, Mitgründer von Gravity, verklagte ihn wegen Benachteiligung der Anteilseigner, da deren Gewinn durch die höheren Löhne geschmälert werde. Zwei langjährige Mitarbeiter verließen das Unternehmen, weil nun jeder fast gleich verdiente.
Doch anders als vielfach vorhergesagt führte der hohe Einheitslohn nicht in den Ruin. Im Gegenteil, Gravity wuchs seit 2015 deutlich. Die Mitarbeiter konnten Häuser kaufen, Familien gründen – die Fluktuation sank auf die Hälfte, und die Produktivität erhöhte sich deutlich. Die Klage des Bruders wurde abgewiesen. Dan Price trat zwar – aus anderen Gründen – 2022 als CEO zurück, in beratender Funktion ist er aber zu Gravity zurückgekehrt.
Radikale Disruption
Die 2010er-Jahre hatten in vielen etablierten Unternehmen einen Schock ausgelöst, weil Start-ups mit ihren digitalen Geschäftsmodellen langjährige Platzhirsche zu verdrängen drohten. Sie waren flexibler, schneller, radikaler als die „alten“ Unternehmen und hatten sich viele Organisationsideen von der Softwareentwicklung abgeguckt. Das Buch „Lean Start-up“ von Eric Ries galt als Pflichtlektüre für den Konzernstrategen, der seinem Haus Start-up-Agilität beibringen wollte. Statt starrer Hierarchien herrschten dezentrale, bereichsübergreifende Teams, die Produkte in „Sprints“ bis zum Status des „Minimum Viable Product“ – vorzeigbar, aber noch nicht gänzlich ausgereift – weiterentwickeln sollten.
Scrum & Co. waren nicht die einzigen Hits dieser Zeit, einige Unternehmen gingen radikal weiter. Unternehmen wie Gravity. Oder, fast noch bekannter: Zappos. Bei dem Onlineversender wurde 2014 ein neues System der Selbstorganisation namens Holacracy eingeführt und sorgte weltweit für Schlagzeilen. Herkömmliche Managerpositionen und Jobtitel wurden abgeschafft, stattdessen ersetzte eine klare Satzung die bisherige Hierarchie. 1500 Mitarbeiter wurden in 400 „Kreisen“ (sprich: Teams) organisiert. Damit sollte Zappos schneller und innovativer werden.
Dezentrale Organisationen
2014 machte auch der Begriff „Teal Organizations“ aus Frederic Laloux’ einflussreichem Buch „Reinventing Organizations“ die Runde. Selbstführung, Ganzheit und evolutionärer Sinn sollten „türkise“ (engl. teal) Organisationen auf die nächste Entwicklungsstufe des dezentralen, sinnorientierten Arbeitens heben. Der niederländische Pflegedienst Buurtzorg hatte bereits 2007 selbstorganisierende Pflegeteams ohne mittleres Management etabliert. Innerhalb weniger Jahre war Buurtzorg auf mehr als 15 000 Mitarbeiter gewachsen und weltbekannt geworden. Teal wurde von vielen Unternehmen eingeführt – vom US-Tomatenverarbeiter Morning Star bis zum französischen Getriebegabel- und Kupferrotorhersteller FAVI.
Die innovativen Unternehmen von damals gibt es auch heute noch, und es geht ihnen gut.
Das schwedische Geldinstitut Handelsbanken hingegen sorgte mit „Beyond Budgeting“ für Schlagzeilen. Anstatt fixer Budgets oder Planvorgaben setzte die Bank – die bereits in den 1970ern klassische Budgets abgeschafft hatte – auf flexible Zielsetzung, rollierende Forecasts und dezentrale Steuerung. Filialen wurden anhand weniger Kennzahlen wie Kundenzufriedenheit und Kosten-Ertrags-Relation gesteuert. Zwischen 2007 und 2015 hatte Handelsbanken einen überdurchschnittlichen Shareholder-Value-Zuwachs. Auch die norwegische Statoil, heute Equinor, führte das agile Beyond-Budgeting-Prinzip ein.
... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.
Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.
Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.
Begeisterung und Ablehnung
In den Organisationen selbst wurden die radikalen Ansätze meist wohlwollend, teils auch begeistert aufgenommen. Die größere Autonomie war motivierend, in vielen Unternehmen verbesserten sich die Finanzkennzahlen. Handelsbanken schaffte es, selbst in der globalen Finanzkrise 2008 profitabel zu bleiben. Außenstehende blieben aber oft skeptisch oder gar ablehnend. Zappos-CEO Tony Hsieh wurde in den Medien einerseits als mutiger Kulturpionier gelobt, andererseits galt Holacracy oft als bürokratisch und zu sehr auf sich selbst fokussiert.
Bei größeren Projekten gab es beim Holacracy-Nachahmer -Medium Koordinationsprobleme; der hohe Aufwand durch die zahlreichen Regeln und Protokolle sorgte dort rasch für Ernüchterung. Der Selbstorganisationsansatz der Teal-Prinzipien wurde nach anfänglicher Begeisterung in vielen Fällen wieder abgeschwächt: Man solle Laloux’ Beispiele nicht überhöhen, kein Unternehmen folge Teal in Reinkultur. Außenstehende haderten mit dem Fehlen klassischer Kontrollinstanzen. Trotz des großen Erfolgs von Handelsbanken blieb Beyond Budgeting ein Nischenansatz. Etablierte Unternehmen scheuten den radikalen Schritt, den gewohnten Budgetierungsprozess aufzugeben – obwohl seine Ineffizienz unumstritten ist.
Geld mit der Gießkanne
Gleiches Gehalt für alle, auch ihn: Dan Price, Gründer von Gravity Payments, machte mit dem 70 000-US-Dollar-Einheitslohn Schlagzeilen.
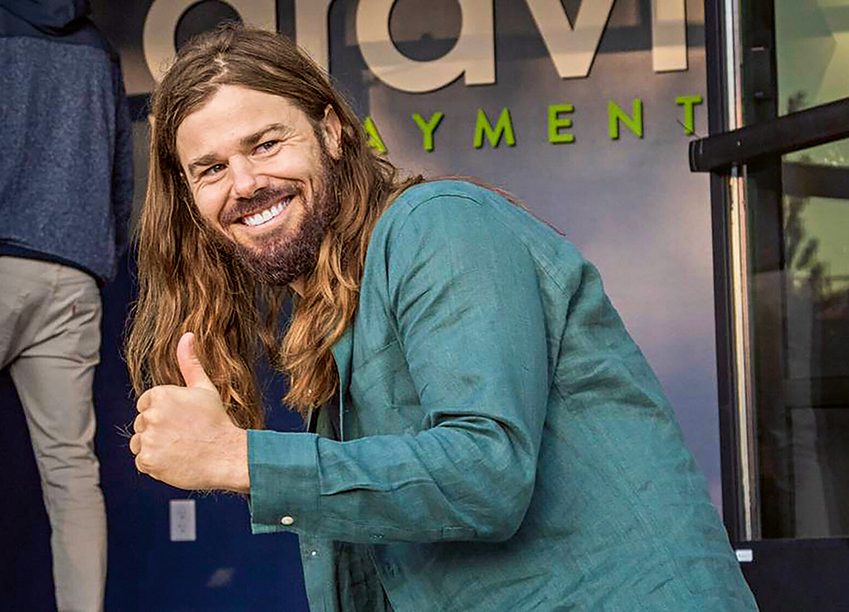
FOTO: PICTURE ALLIANCE/ZUMAPRESS.COM/ K. JONES
Auch zeigte sich, dass es ohne einen charismatischen Gründer oder CEO schwer wird, die radikalen Modelle beizubehalten oder zu adaptieren. Fehlt das emotionale Investment an der Spitze, sind Manager schnell geneigt, bei Problemen in etablierte Muster zurückzufallen. Auch langjährige Mitarbeiter sowie Investoren, Aufsichtsräte und Kunden signalisierten: Wir wollen keine Veränderung, keine Experimente. In einigen regulierten Bereichen setzten Bankenaufsicht & Co. enge Grenzen. Ansätze wie Holacracy ließen sich zudem nur schwer skalieren, teilweise war der finanzielle Nutzen des Neuen nicht erkennbar.
Wenige Nachahmer
So blieb es bei wenigen Nachahmern. Die Website „Reinventing Organizations Wiki“ nennt weltweit nicht einmal 30 Teal-Organisationen. Davon haben viele nur einen Bruchteil der Teal-Ideen umgesetzt. Aus Deutschland sind immerhin vier Namen aufgeführt – darunter die Kreativagentur Elbdudler und die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Die Website „Corporate Rebels“ hat die Definition weiter gefasst und listet mehr als 150 Unternehmer und Personen als „Pioniere“ auf, darunter Premium Cola aus Hamburg, Wildling Shoes aus Engelskirchen und den Berliner Kondomhersteller Einhorn.
Doch die innovativen Unternehmen von damals gibt es auch heute noch, und es geht ihnen gut. Ihre radikalen Ansätze waren nicht existenzgefährdend. Handelsbanken zeigt seit Jahrzehnten eine überdurchschnittliche Leistung, Buurtzorg ist etablierter Marktführer in der häuslichen Krankenpflege in den Niederlanden. Gravity hat den Einheitslohn inzwischen auf 80 000 US-Dollar angehoben, und auch der norwegische Nachahmer SafetyWing praktiziert bis heute „gleiche Löhne für alle Mitarbeiter“. Der chinesische Haushaltsgeräteriese Haier mit seinen 80 000 Mitarbeitern ist weiterhin in 4000 autonome Mikro-Enterprise-Einheiten zerlegt und konnte so dauerhaft 10 000 Managementstellen einsparen. Das „RenDanHeYi“-Modell funktioniert bestens, Haier hält inzwischen 15 Prozent am weltweiten Markt für große Haushaltsgeräte.
Zappos, seit 2009 Tochter von Amazon, geht es ebenfalls weiterhin gut. Seit 2017 ist das Unternehmen allerdings vom radikalen Holacracy-Ansatz abgerückt, zu rigide, zu bürokratisch waren die Treffen. Inzwischen gibt es wieder Manager. Doch es gilt noch immer ein dezentrales System, das Selbstbestimmung hochhält
09/2025
Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.


